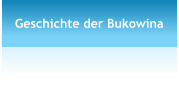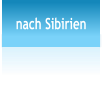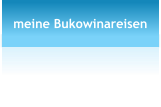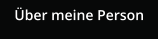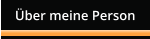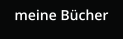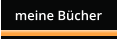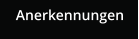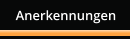© DS Werbedesign 2020



aus der Bukowina
Meine Rückführung 1945 nach Rumänien und 1946 wieder nach Deutschland zurück
Am 16. Januar 1945 flüchtete ich –Willi Kosiul- durch widrige Umstände alleine –in aller Eile- ohne meine Familie, aus Oberschlesien in
Richtung Westen. Im Trubel der sich zurückziehenden Wehrmachtskolonnen von der Ostfront sowie der dortigen
buchenlanddeutschen Flüchtlinge, war ich als 14-jähriger Junge mit einigen unserer Sachen auf einem requirierten polnischen
Pferdewagen im Treck. Erst nach über zwei Wochen Flucht, fand mich meine Mutter an einer Kreuzung im Raum Cottbus zufällig in
der dort vorbeifahrenden Pferdewagenkolonne.
Nach über vier Wochen Flucht landeten wir Mitte Februar 1945 im Erzgebirge, das bereits von Flüchtlingen und Soldaten, besonders
mit Verwundeten überfüllt war. Dort erlebten wir im Mai 1945 das Kriegsende. Hier lebten wir Flüchtlinge in verschiedenen
Notunterkünften, hatten keine Arbeit und nur sehr wenig zu Essen, da auch auf den nur geringen Lebensmittelkarten, beim Bäcker
und in den Geschäften kaum etwas zu kaufen gab. Es wurde viel gehungert und die Lebensumstände waren dort nicht länger zu
ertragen. Im Sommer 1945 wurden im Erzgebirge die Familienvorstände der buchenlanddeutschen Flüchtlinge zur dortigen
sowjetischen Kommandantur vorgeladen. Dabei wurde ihnen mitgeteilt, dass sie sofort den Raum Erzgebirge zu verlassen hatten,
damit das übervölkerte Gebiet von all den Flüchtlingen befreit wird und die Alteinwohner besser versorgt werden können.
Alle Flüchtlinge sollten dort hin fahren, wo sie am 01.September 1939 gewohnt und gelebt hatten. Danach sollten alle
buchenlanddeutschen Flüchtlinge nach Rumänien zurück. Ob in die sowjetische Nordbukowina oder in die rumänische Südbukowina,
davon war gar nicht die Rede. Da unsere Leute die damaligen politischen Herrschaftsverhältnisse in der Bukowina nicht kannten,
hatten sie auch nicht danach gefragt.
Die buchenlanddeutschen Flüchtlinge sollten sofort das Erzgebirge verlassen und sich nach Leipzig in das rumänische
„Rückführungslager“ begeben, von wo sie in Sammeltransporten nach Rumänien zurückgebracht werden. Wer diesen Befehl des
sowjetischen Kreiskommandanten von Schwarzenberg nicht befolgt und sofort das Erzgebirge verlässt, dem werden die
Lebensmittelkarten entzogen und der wird danach auch mit Gewalt von hier ausgewiesen. Verängstigt und eingeschüchtert kamen
die Familienvorstände der buchenlanddeutschen Flüchtlinge vom sowjetischen Kreiskommandanten aus Schwarzenberg mit der
Botschaft zurück, sofort das Erzgebirge zu verlassen und über Leipzig nach Hause nach Rumänien zurückzukehren.
Danach verkauften unsere Leute dort ihre Pferde und Wagen, packten ihre wenigen Sachen von der Flucht aus Oberschlesien,
mieteten sich Lastkraftwaren an und führen damit im August 1945 nach Leipzig in dieses besagte Lager und meldeten sich dort zur
Rückführung nach Rumänien an. Dieses rumänische Rückführungslager war ein offenes Sammellager für alle, die zurück nach
Rumänien wollten oder sollten. Es war ein großes Barackenlager, mit eisernen Betten und Strohsäcken sowie einigen Tischen und
Stühlen. Da dort genug Platz für alle war, konnten sich die Familien ihre Zimmer selber aussuchen.
Zum Leidwesen der Barackenbewohner gab es in den Zimmern wo wir wohnen und schlafen mussten- mehr Wanzen, Läuse und
Flöhe als abgewehrt und bekämpft werden konnten. Die Verpflegung aus der eigenen Lagerküche bestand hier mehr aus Suppen als
aus festen Mahlzeiten. Drei Mal täglich gab es dieses Essen, das für uns ausgehungerten Flüchtlinge aus dem Erzgebirge bei Weitem
nicht ausreichte. Hier wurden wir für den Rückführungstransport nach Rumänien registriert, mit dem Hinweis, dass der Abtransport
nach Rumänien erst erfolgen wird, wenn genügend Personen dafür zusammen sind. Bis dahin sollten wir geduldig darauf warten.
Das Lagertor war stets offen. Am Lagereingang hingen am Mast die sowjetische und die rumänische Staatsflagge. Die
Lagerwachmannschaft bestand aus einigen buchenlanddeutschen Männern, die aber nur oberflächlich den Eingang ins Lager
kontrollierten, und nur darauf, dass hier keine Fremden eindringen konnten. Nach etwa zwei Wochen Lageraufenthalt in Leipzig kam
um Mitte August 1945 der Befehl zur Abreise nach Rumänien. Sowjetische Militärfahrzeuge erschienen im Lager, die alle
Lagerinsassen mit ihrem Gepäck zum Bahnhof Leipzig beförderten.
Abseits des Bahnhofs stand ein sehr langer Güterzug auf einem Abstellgleis, der für unsere Reise bestimmt war.
Der erste Waggon war für die sowjetische Bewachung reserviert und alle anderen Waggons konnten nach Belieben Familienweise
bestiegen und besetzt werden bis sie voll waren. Da es in allen Waggons einen horizontalen Brettereinzug gab, hatten die Waggons
zwei Etagen und dadurch passten in jeden Wagen sehr viele Personen hinein. Unser Transport soll insgesamt etwa 2.000 Personen
und 30 sowjetische Soldaten gehabt haben. Die sowjetische Wachmannschaft hatte die Aufgabe, unseren Transport vor Übergriffen
bzw. Überfällen von außen zu schützen und hielt sich daher immer in ihrem ersten Waggon auf. Nachdem wir alle die Waggons
bestiegen und besetzt hatten, kam ein deutsch sprechender sowjetische Offizier die Waggon entlang und forderte alle
Waggongemeinschaften auf, aus ihrer Mitte einen Waggonältesten zu bestimmen. Dieser sollte danach zu einer bestimmten Zeit
beim sowjetischen Transportkommandanten sich zu einer Besprechung einfinden, was danach auch so geschehen war.
Danach teilte uns unser Waggonältester mit, dass wir demnächst von hier nach Rumänien abfahren, sobald eine Lokomotive für
unseren Transport vorhanden ist. Auch wie wir uns während der Fahrt sowie auch an den Zughaltestellen verhalten sollten, erläuterte
er uns. Wir müssten uns überwiegend selber verpflegen und bei Angriffen von außen die Wachmannschaft um Hilfe rufen und dazu
die Waggontüren sofort schließen. Nach einiger Zeit erhielt unser Transportzug eine Lokomotive und der Zug setzte sich in
Bewegung. Da merkten wir, dass unser Transport nicht nach Südosten durch die damalige CSSR und Ungarn nach Rumänien fuhr, wie
man es uns vorher gesagt hatte, sondern nach Nordosten in Richtung Polen – Sowjetunion. Sofort kippte die Stimmung unter
unseren Leuten und verschiedene spekulative Gedanken beherrschten die Unterhaltungen, wie:
- Es geht nach Polen in unsere östlichen deutschen Ansiedlungsgebiete, wo wir dort den Polen
übergeben und zu Sklavenarbeitern der Polen gemacht werden.
Oder
- es geht nach Sibirien zur dortigen Zwangsarbeit, um am Wiederaufbau der sowjetischen Wirtschaft und
des Landes teilzunehmen.
- Die dritte aber auch schwächste Version lautete: Es geht –wie wir 1940 aus der Nordbukowina
gekommen sind- durch Polen über Krakau – Lemberg – und nach Czernowitz, und die
Südbuchenländer weiter nach Suczawa.
Diese laienhafte spekulative Diskussion wurde bis Frankfurt an der Oder geführt und danach verstummte sie.
Als unser Transportzug in Frankfurt/Oder ankam und auf ein Nebengleis abgestellt wurde, hieß es „alles aussteigen und mit Gepäck
den Zug verlassen“, weil unser Zug für einen sowjetischen Militärtransport gebraucht wurde. Wir bekämen erst in einigen Tagen einen
neuen Zug und danach ginge es weiter. Hier in Frankfurt/Oder stiegen wir alle befehlsmäßig mit unserem Gepäck aus dem Zug und
belagerten mit diesen etwa 2.000 Personen ein großes Bahngelände, was der damaligen Deutschen Reichsbahn gar nicht passte.
Darum wurden wir alle etwa 2 bis 3 km außerhalb der Stadt -auf eine große Wiese- gebracht, wo wir bei Wind und Wetter sowie bei
viel Sommerregen, mehrere Tage unter freiem Himmel verbringen mussten. Auch hier gab es für uns keine Verpflegung, keine
Waschgelegenheit und auch keine Toiletten. Alles mussten wir hier im Freien selber regeln. Wir saßen Tag und Nacht auf unserem
Fluchtgepäck, deckten uns mit Decken zu, schliefen angezogen sitzend und kochten am Lagerfeuer –über zwei Ziegelsteine- uns
etwas zu essen.
Nach etwa zwei Wochen Aufenthalt auf der Wiese hieß es, alles zum Bahnhof, der Zug für unsere Weiterfahrt ist da.
Nun trugen wir wieder unser Gepäck, bestehend aus Koffer, Säcken und großen Bündeln, auf dem Rücken diese 2 – 3 km Entfernung
zum Bahnhof, wie vorher vom Bahnhof hier her. Immer in kurzen Etappen sowie in mehreren Gängen und mit der Vorsicht, dass es
nicht verloren geht oder gar gestohlen wird. Der lange Zug stand am Bahnhof auf einem Abstellgleis, die Wagen auch zweistöckig
ausgestattet, so dass wir der Meinung waren, dass es derselbe Zug war, der uns von Leipzig nach Frankfurt/Oder gebracht hatte.
Wir bestiegen den Zug wie und wo jeder wollte und danach führ der Zug mit uns ab. Wohin, wussten wir nicht. Daher waren die Leute
neugierig, wohin die Reise gehen würde. Der Zug fuhr für uns überraschend nach Süden, über Dresden – Prag – Budapest- in
Richtung Rumänien. Aber mit sehr vielen Aufenthalten auf Bahnhöfen, auch zwei bis mehrere Tage ohne Lokomotive auf
Abstellgleisen. So ging es bis Mitte Oktober 1945, wo wir in Arad/Rumänien angekommen waren.
In Arad waren wir mit unserem Gepäck ausgestiegen und der sowjetische Transportkommandant hatte uns dort den rumänischen
Behörden übergeben.
So waren wir mit etwa 2.000 Personen in diesem Rückführungstransport, überwiegend Frauen und Kinder sowie alte Leute, von
August bis Oktober 1945 in einer ausgedehnten Zugreise von etwa acht Wochen aus Deutschland nach Rumänien gefahren. Dabei
gab es sehr viele Fahrtunterbrechungen wegen der zeitweilig fehlenden Lokomotiven für unseren Zug. So wurde uns damals die
Lokomotive auch unterwegs abgenommen, da sie für Militärtransporte benötigt wurde. Dann mussten wir oft auch zwei bis drei Tage
auf einem Abstellgleis warten bis unser Transport wieder eine Lokomotive erhalten hatte.
So ging es von Leipzig bis nach Arad in Westrumänien nur Etappenweise und mit vielen, auch größeren Unterbrechungen.
In dieser Zeit unserer achtwöchigen Reise von Deutschland nach Rumänien gab es für uns von staatlichen oder sonstigen Stellen
weder etwas zu trinken noch etwas zu essen. Wir waren in dieser Zeit Selbstversorger. Alle musste zusehen, wo etwas zu Trinken und
zu Essen besorgt werden konnte. Dazu wurden die langen Wartezeiten ohne Lokomotive auf den Bahnhöfen genutzt, um dort die alte
Deutsche Reichsmark umzutauschen oder Sachen zu verkaufen, um Geld für den Ankauf von Verpflegung zu bekommen.
Alle diese Handlungen mussten immer in der Nähe unseres Transportzuges geschehen, um diesen immer im Auge zu gehalten, damit
er nicht abfährt und Leute zurückbleiben. Die Lokführer sowie unser sowjetischer Transportkommandant hatten darauf keine
Rücksicht genommen. Jeder war da für sich selber verantwortlicht und musste auf alles achten.
Gekocht wurde am Abstellgleis, auf zwei Ziegelsteinen und als Brennholz wurde das verwendet, was gerade in der Nähe dafür
greifbar war. Auch Zaunlatten und Bretter wurden dazu verwendet.
In diesen zwei Monaten wurden auf dem Transport Kinder geboren, es gab Erkrankungen und auch Sterbefälle. Die Toten wurden
jeweils an der nächsten Haltestelle unseres Zuges am Bahndamm oder daneben beigesetzt. Da die Leute keine Spaten oder
Schaufeln hatten, wurde nur eine flache Grube gemacht, die Toten in der Tageskleidung reingelegt und mit Erde oder
Bahndammschotter zugedeckt. So gab es während unserer Fahrt in Leipzig bis zur Ankunft in Arad verschiedene –auch- unerfreuliche
Ereignisse, Unfälle an den Bahngleisen, Krankheiten und auch Todesfälle von Kindern oder alten bzw. sehr kranken Leuten. Die
Beerdigung musste primitiv und oft auch auf die „Schnelle“ bewältigt werden.
In Arad belagerten wir mit etwa 2.000 Personen und unserem Gepäck für einige Tage das rumänische Eisenbahngelände, bis wir nach
der polizeilichen Anmeldung weiterfahren durften.
Alle Familienvorstände mussten mit den Unterlagen ihrer Personalien zur dortigen rumänischen Gendarmerie gehen und ihre
Familien polizeilich anmelden. Dort war bereits bei der polizeilichen Anmeldung von den Beamten zu vernehmen, dass wir Deutsche
und einstige Umsiedler in Rumänien nicht willkommen waren.
Hier erklärte man uns eingereisten Deutschen bei der Anmeldung folgendes:
- Durch unsere Umsiedlung 1940 in das damalige Deutsche Reich hatten wir die rumänische
Staatsbürgerschaft verloren. Heute würden wir hier in Rumänien nur als geduldete deutsche Ausländer
angesehen und als solche behandelt werden.
- Alle Deutschen aus der rumänischen Südbukowina besitzen hier durch ihre Umsiedlung 1940 in das
Deutsche Reich kein Eigentum mehr und haben auf ihr damals zurückgelassenes Vermögen kein
Anrecht, weil ihr damaliges Eigentum in das des rumänischen Staates übergegangen war.
- Sie hätten auch kein Anrecht in ihre ehemaligen Häusern oder Dörfer zurückzukehren, dort
einzuziehen und dort zu wohnen, auch nicht als Mieter. Sie sollten diese Dörfer als Wohnort meiden.
- Alle Deutschen aus der sowjetischen Nordbukowina dürfen aus Rumänien nicht in die sowjetische
Nordbukowina fahren und haben sich hier in Rumänien an einem Ort ihrer Wahl aufzuhalten.
- Alle eingereisten deutschen Ausländer haben keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung.
Sie haben ihre Weiterreise zum neuen Wohnort ihrer Wahl selber zu finanzieren, sich dort sofort
selbstständig eine Unterkunft zu besorgen und sich innerhalb von 24 Stunden- bei der örtlichen
Gendarmerie polizeilich anzumelden.
Danach erhielt jede Person ab dem 14. Lebensjahr ein Stück beschriebenes Pergamentpapier als vorläufigen Personalausweis, in der
Größe von etwa 5 cm x 15 cm, mit den notwendigen Daten der Personalien und das Dienstsiegel darauf, ohne Passbild.
Danach konnte jeder von uns in Rumänien auf eigene Kosten auf die Reise gehen, wohin er wollte. Da wir alle eingereisten Deutschen
kein rumänisches Geld hatten, konnten wir uns noch keine Fahrkarten kaufen und daher auch noch nicht weiterreisen. Deswegen
mussten wir hier noch eine Nacht im Freien verbringen, bis wir am nächsten Morgen auf dem dortigen Basar bei den jüdischen
Händlern inoffiziell unsere mitgebrachte Deutsche Reichsmark in rumänische Lei umtauschen konnten.
Diesen möglichen Geldumtausch mit der Deutschen Reichsmark kannten wir schon von unserer bisherigen Reise, wo wir auch in
Ungarn, die Reichsmark gegen das damalige ungarische Pengö günstig umtauschen konnten. Dadurch war auf dieser Fahrtstrecke
durch Ungarn unsere Verpflegung bestens gesichert.
Inzwischen wurden die eingereisten deutschen Familien sich einig, wo sie danach hinfahren wollten und welcher Ort ihr neuer
Wohnort werden sollte. Dabei entschieden sich mehrere Familien aus der Nordbukowina (so auch wir) für Radautz, als unser neues
Reiseziel und auch als neuer Wohnort. Da auf der nördlichen Eisenbahnlinie Arad – Oradea – Cluj Napoca – Bistritza – Vatra Dorna –
Suczawa, im Karpatengebirge von den dortigen Kriegshandlungen im Herbst 1944 noch nicht alle Kriegsschäden beseitigt waren und
diese Eisenbahnlinie noch nicht durchgängig befahrbar war, mussten wir die südliche Einsenbahnlinie in Anspruch nehmen. Die war
aber bedeutend länger. Mit mehreren Familien -in größeren Gruppen- ging es mit der rumänischen Eisenbahn von Arad nach Plojesti
und von dort über Buzau – Fokschani - Bacau – Suczawa – nach Radautz. Das war für uns ein großer Umweg und auch viel teurer mit
noch einem Hindernis. Auf dieser Strecke war zwischen Bacau und Piatra Neamtz die Eisenbahnstrecke noch nicht befahrbar, da sie
bei den Kampfhandlungen im Sommers 1944 im Frontabschnitt Jassy beschädigt wurde und bisher noch nicht instand gesetzt war.
Darüber wurden wir in Arad beim Fahrkartenkauf nicht informiert und waren erst unterwegs davon überrascht. So mussten wir in
Bacau –mit unserem Gepäck diesen Zug verlassen, uns dort ein Pferdegespann anmieten und mit diesen Pferdewagen die etwa 60
km bis Piatra Neamtz fahren, um dort in den Zug zu steigen und unsere Fahrt nach Suczawa – Radautz fortzusetzen. Ende Oktober
1945 waren wir (meine 59-jährige Mutter und ich als 15-jähriger Junge) in Radautz angekommen, suchten uns sofort ein
Privatquartier und meldeten uns am nächsten Vormittag –mit unserem in Arad erhaltenen Pergament-Papierstreifen als
Personalausweis-, bei der dortigen Gendarmerie. Die registrierten uns, vermerkten darauf unsere Unterkunft, stempelten es ab und
damit war die polizeiliche Anmeldung erledigt. Damit waren wir in Radautz geduldete deutsche Ausländer. Doch wie lange wir hier
bleiben wollten und wie es überhaupt mit uns weiter gehen sollte, das wussten wir selber nicht. So lebten wir in Radautz als deutsche
Ausländer von einen Tag auf den anderen, ohne eine Arbeit und ohne Geld. Dabei hatten wir unsere Miete für eine Sommerküche
monatlich an eine rumänische Frau zu bezahlen, Brennholz für den Küchenherd sowie für die Beheizung unserer Unterkunft für den
Winter und dann auch noch unsere Verpflegung zu kaufen.
Da hier in Radautz für mich keine Arbeit zu finden war und wir dadurch kein finanzielles Einkommen hatten, waren wir darauf
angewiesen, unsere noch vorhandene Deutsche Reichsmark auf dem Basar bei den jüdischen Händlern inoffiziell gegen rumänische
Lei umzutauschen. Auch hatten wir auf dem Basar in Radautz die Möglichkeit, einige von unseren mitgebrachten Sachen (wie
Haushaltswäsche oder unsere Bekleidung) zu verkaufen, um dadurch zu rumänischem Geld zu kommen und davon leben zu können.
Das war für uns einige Zeit möglich, aber wie lange und was danach, wenn alles aufgebraucht ist?
So lebten wir dort in Radautz hoffnungslos in den Tag hinein, ohne zu wissen, was uns morgen erwartet.
Wir jüngeren Deutschen aus der Nordbukowina, die jetzt in Radautz waren, trafen uns fast jeden Vormittag auf dem dortigen Basar,
um gegenseitig etwas Neues zu erfahren und unsere Informationen auszutauschen.
Am Sonntagvormittag trafen sich noch viel mehr Nordbuchenländer –auch die Alten- in der römisch-katholischen Kirche in Radautz,
um sich vor dem Gottesdienst sowie auch danach über verschiedene Dinge zu unterhalten.
Meine Mutter und ich, waren dort in Radautz sehr daran interessiert, etwas über unseren ehemaligen alten Heimatort Czudyn –aus
der sowjetischen Nordbukowina- und unsere 1940 dort zurückgebliebenen Verwandten zu erfahren.
Mein Vater sowie auch mein ältester Bruder hatten -mit seiner rumänischen Familie- im Herbst 1940 nicht an der Umsiedlung in das
Deutsche Reich teilgenommen, sie sind dort in unserem Wohnhaus sowie auf unserem Grundstück –unter sowjetischer Herrschaft-
zurückgeblieben. Deshalb hatten wir im Herbst 1945 in Radautz, ein sehr großes Interesse daran etwa über diese unsere Verwandten
aus Czudyn zu erfahren, ob sie dort noch leben und wie es ihnen geht. Trotz aller unserer umfassenden Bemühungen und internen
Nachforschungen, war es uns nicht gelungen, etwas darüber zu erfahren.
Erst viel später hatten wir dann in Deutschland erfahren, das mein Vater im Herbst 1945 noch gelebt und dort in Czudyn in unserem
Haus auch gewohnt hatte. Er ist im März 1946 dort verstorben. Mein ältester Bruder war im März 1944 mit seiner rumänischen
Familie noch vor dem Einmarsch der Roten Armee in die Nordbukowina, nach Altrumänien geflüchtet und war zu diesem Zeitpunkt
–im Herbst 1945- in Arad wohnhaft, wo wir kurz zuvor durchgekommen waren. Daher war damals über meinem in Arad lebenden
Bruder in Radautz nichts zu erfahren. So verging eine Woche nach der anderen und wird hatten immer noch keine Lösung, wie es mit
uns 1946 weiter gehen sollte, bis der damalige rumänische Staat im Dezember 1945 über unser weiteres Schicksal bestimmte.
Ab Anfang Dezember 1945 begann die rumänische Gendarmerie in Radautz die bisher geduldeten deutschen Ausländer aus der
sowjetischen Nordbukowina, die im Kreisgebiet von Radautz wohnhaft waren, festzunehmen und zu internieren.
Dazu wurden wir in den Morgenstunden zwischen 05.00 Uhr und 06,00 Uhr, in unseren Wohnungen überraschend aufgesucht, die
Männer und Frauen (von 14 bis 50 Jahren, ohne Kinder) festgenommen und ohne Handgepäck- der Gendarmerie in Radautz
zuzuführen. Hier wurden alle registriert und danach in das „Deutsche Haus“ in Radautz gebracht, wo alle unter ständiger
Gendarmeriebewachung, interniert wurden. Die geduldeten deutschen Ausländer aus der rumänischen Südbukowina waren davon
nicht betroffen, sie durften dort in ihren Wohnunterkünften auch weiterhin verbleiben.
Einen Tag nach Weihnachten, am 27. Dezember 1945 zwischen 05,00 Uhr und 06,00 Uhr, wurde auch ich als 15-jähriger Junge, in den
Morgenstunden, aus meiner Wohnunterkunft, durch zwei Gendarmeriemänner mit langen Karabinern (Kaliber 98, aus dem Ersten
Weltkrieg) abgeholt und zur Gendarmerie-Dienststelle gebracht. Da wir (meine Mutter und ich) noch schliefen, wurde ich aus dem
Bett geholt, mit der Aufforderung: „Aufstehen, anziehen und sofort mitkommen!“ Warum und weswegen oder für wie lange, wurde
mir nicht gesagt und da waren auch keine Fragen zu stellen. Da wir von dieser „Verhaftungs- und Internierungswelle“ der
Nordbuchenländer schon wussten, waren wir darauf auch eingestellt und hatten schon täglich darauf gewartet. Daher waren wir von
meiner Festnahme gar nicht überrascht und hatten dazu auch keine Fragen an die Gendarmeriemänner.
Ich stand sofort aus meinem Bett auf, zog mich warm an, nahm mir nur noch etwas zu Essen mit und folgte den Befehlen der
Gendarmeriemänner, ohne mich zu waschen und etwas zu essen. Dafür war keine Zeit, denn meine Bewachung drängte auf Eile.
Daher hatte ich nur meine angezogene Kleidung mit, kein Handgepäck, kein Waschzeug und auch keine Decke.
Meine Mutter –damals 59 Jahre alt- war davon nicht betroffen. Sie durfte in unserer dortigen Wohnunterkunft zurückbleiben und auf
unsere wenigen Sachen aufpassen, damit diese nicht gestohlen werden.
So wurde ich –von meinen beiden Wachmännern begleitet- zur Gendarmerie-Dienststelle Radautz gebracht, wo sich bereits mehrere
Nordbuchenländer befanden und wir uns auch alle kannten.
Hier wurde mir der Personalausweis-Schein abgenommen, den wir bei der Einreise in Arad erhalten hatten. Ich wurde registriert und
gegen Mittag wurden wir alle Festgenommenen zu Fuß unter Bewachung zum „Deutschen Haus“ ins Internierungslager gebracht.
Weder bei unserer Registrierung in der Gendarmerie-Dienststelle noch im improvisierten Internierungslager im „Deutschen Haus“
hatte man uns gesagt, warum sie uns inhaftiert und interniert hatten, wie lange es so dauern wird und was sie mit uns vor hatten.
Solche Fragen waren dort nicht angebracht und wurden auch nicht beantwortet. Daher stellten wir sie auch nicht.
Wir warteten nur geduldig auf unser kommendes Schicksal. Das „Deutsche Haus“ in Radautz wurde beim Einmarsch der Roten Armee
im Frühjahr 1944 durch Kriegseinwirkungen z. T. beschädigt, danach durch Radautzer Bewohner auch noch teilweise abgetragen, wie
Türen und Fenster entnommen. Trotzdem wurde die erste Etage des unbeschädigten Teils als deutsches Internierungslager genutzt,
weil hier eine höhere Sicherheit gegeben und von hier aus eine Fluchtgefahr kaum gegeben war.
Da das Erdgeschoss ohne Türen und Fenster war, blieb es leer.
Die Männer und Frauen wurden getrennt und massenweise in den oberen Räumen untergebracht. Diese Räume waren leer, hier gab
es für uns weder Betten noch eine Sitzgelegenheit. Geschlafen und gesessen wurde auf dem blanken Fußboden, alles in unserer
Tageskleidung, die jeder anhatte.
Essen gab es für uns nur ein Mal am Tage, jeweils am Vormittag, 300 Gramm Brot pro Person und schwarzen Ersatzkaffe oder
Leitungswasser. Mehr nicht. Die Räume waren durchgehend sehr unsauber, für uns keine Waschgelegenheit und bald gab es hier
Läuse und Flöhe, die uns Tag und Nacht beschäftigten. In diesen großen Räumen war nur ein alter verbrauchter Kachelofen, der jetzt
im Dezember/Januar, bei klirrender Kälte diese Räume nicht genügend beheizen konnte. Dazu kam noch die Brennholzknappheit. Wir
erhielten täglich nur etwas Brennholz zugeteilt und mussten damit auskommen. Dadurch gesellte sich dort zu unserem ständigen
Hunger noch die Kälte, die wir in voller Tageskleidung, ertragen mussten. Die Bewachung bestand aus zwei älteren
Gendarmeriemännern mit den langen Karabinern, einer war der Außenposten und der andere für die innere Sicherheit. Sie lösten
sich alle 2 Stunden gegenseitig ab. Für uns gab es hier keinen Ausgang und auch keine Besuche bzw. Kontakte mit unseren
Angehörigen. Uns durfte von außen auch keine Verpflegung durch unseren Angehörigen gebracht werden.
So saßen wir alle hier untätig von einem Tag auf den anderen, von Anfang Dezember 1945 bis Anfang Februar 1946, ohne zu wissen,
wie lange und was aus uns werden sollte. Wir diskutierten unter uns alle spekulativen Möglichkeiten, was vermutlich die Rumänen
mit uns machen werden. Anfang Februar 1946 wurde auf dem Bahnhof Radautz für uns ein Güterzug mit geschlossenen Waggons
–auf dem Abstellgleis bereitgestellt, der unter rumänischer militärischer Bewachung stand.
Danach wurden alle buchenlanddeutschen Frauen mit ihren kleinen Kindern sowie die alten Umsiedler aus der sowjetischen
Nordbukowina, die nicht interniert waren (wie auch meine Mutter), durch die Radautzer Gendarmerie –mit ihrem gesamten Gepäck-
aus ihren Wohnunterkünften geholt und zum Bahnhof in Radautz gebracht. Hier wurden sie alle mit ihrem gesamten Gepäck der
dortigen rumänischen Militärwachmannschaft übergeben und durch diese in die Güterwagen einwaggoniert. Anschließend wurden
wir, die deutschen Frauen und Männer die im „Deutschen Haus“ in Radautz interniert waren, in langer Fußmarschkolonne, unter
Gendarmerie-Bewachung zum Bahnhof gebracht und dort der rumänischen Militärwachmannschaft übergeben. Hier suchte jeder
seine Familie –die schon in den Waggons untergebracht waren- und nahm dort einen Platz ein. Auf diesem Transport waren wir
insgesamt etwa 650 Personen, überwiegend Frauen, Kinder und alte Leute. Nur wenige jüngere Männer waren dabei, die 1945 nicht
in Gefangenschaft geraten waren. Da der Transportzug noch keine Lokomotive hatte, mussten wir noch zwei bis drei Tage darauf
warten und standen jetzt unter rumänischer militärischer Bewachung, was für unsere Zukunft nicht gut aussah.
Im Transportzug kamen wieder spekulative Gespräche auf, wie: „der Rumäne will uns nicht haben, er will uns loswerden und wird uns
deshalb –hier an der rumänisch-sowjetischen Grenze- den Russen übergeben. Der Russe wird uns danach in die Nordbukowina oder
gar nach Sibirien bringen.“ Usw.
In dieser Wartezeit auf dem Bahnhof im Radautz sowie auch auf dem weiteren Transport, gab es für uns weder etwas zu Trinken noch
zu Essen. Auch hier waren wir Selbstversorger. Die rumänische Militärwachmannschaft ließ auf dem Bahnhof in Radautz, aus einem
Waggon jeweils nur eine Person (Frau oder Kind, keine Männer) in die Stadt gehen, um Essen zu kaufen. Wenn diese Person vom
Einkauf zurück war, durfte die nächste Person zum Einkauf gehen. So mussten wir uns behelfsmäßig versorgen und auch für den
folgenden Transport vorsorgen. Dann erhielt unser Transport eine Lokomotive und der Zug setzte sich in Bewegung.
Die Wachmannschaft hatte alle unsere Waggons von außen geschlossen sowie verriegelt und befand sich danach im ersten Waggon
hinter der Lokomotive, der für sie reserviert war. Nach der Abfahrt unseres Zuges waren wir alle gespannt, in welcher Richtung der
Transport fährt. Die Leute nutzten dazu jeden „Auskuck“ aus dem geschlossenen Zug. Geht es nach Norden, dann geht es in die
sowjetische Nordbukowina oder geht es nach Südosten, dann geht es über Jassy in die Sowjetunion und nach Sibirien.
Da aber der Zug nach Süden und danach nach Westen fuhr, gab diese neue Richtung den Spekulationen neuen Diskussionsstoff, bis
wir in Oradea ankamen.
In Oradea wurden wir –Mitte Februar 1946- in der dortigen Festungsburg untergebracht, in großen kalten dunklen Räumen, die auch
nur dürftig beheizt wurden. Hier wurden wir nach einer Registrierung Familienweise auf die jeweiligen Stuben, in diesen großen
Räumen eingewiesen. Jeweils ein Mann aus unserer Mitte wurde sofort von der Wachmannschaft als Stubenältester eingesetzt.
Die Wachmannschaft bestand aus rumänischen Soldaten. Jeden Abend gab es dort –durch einen Sergeanten- einen
Stubendurchgang, wo nach der Stubenliste alle Insassen aufgerufen und so ihre Anwesenheit bzw. die Vollzähligkeit genau überprüft
wurde. Sie taten so als wenn sie Angst hätten, dass wir von dort aus flüchten könnten.
Wenn das große dicke Tor der Festungsburg geschlossen wurde, war hieraus eine Flucht unmöglich.
Das Essen wurde drei Mal täglich stubenweise in Eimern in der Lagerküche empfangen und auf die Stuben gebracht, wo es in
Schüsseln an die Stubeninsassen ausgegeben wurde. Es bestand meist aus der rumänischen Maismehlspeise „Mamaliga“, die meist
schon kalt, sehr weich und sehr klebrig war sowie auch aus verschiedenen dünnen Wassersuppen. Und das nur in kleinen Portionen.
Die dürftigen Waschgelegenheiten sowie die Toiletten waren im Keller und alles auch sehr unsauber.
Eine medizinische Versorgung war gar nicht vorhanden. Die Kranken mussten durchhalten, wieder gesund werden oder sie sind
daran gestorben. Das alles hatte den dortigen militärischen Lagerkommandanten gar nicht interessiert.
Alle Männer von 14 bis 60 Jahren waren täglich zur Arbeit verpflichtet, von 08,00 Uhr bis 18,00 Uhr, entweder in der Festung oder in
bewachten Arbeitskommandos außerhalb in der Stadt. Jeden Morgen war für die arbeitspflichtigen Männer um 08,00 Uhr auf dem
Burghof Antreten zur Arbeitseinteilung nach Berufsgruppen. Danach ging es zur Arbeitsstelle.
Auf der Burg gab es eine Schlosserei, Elektrikerabteilung, Schuhmacherei, Seilerei, Korbflechterei, usw. die Reparaturarbeiten oder
auch Neuanfertigungen machten, wo gelernte Handwerker ständig gearbeitet hatten. Wir jungen Burschen sowie auch die älteren
ungelernten Männer wurden diesen Berufsgruppen und Arbeitsstellen als Hilfskräfte und Handlanger zugeteilt oder wurden zu den
verschiedenen Arbeiten auf die Außenstellen geschickt, die unter strenger militärischer Bewachung waren. Niemand hatte uns
informiert, wie lange wir dort bleiben müssen und was aus uns werden sollte. Diese Ungewissheit nagte an den Nerven der Leute
und stumpfte sie von Tag zu Tag immer mehr ab. Alle Anfragen an den Lagerführer waren dort gar nicht erwünscht und wurden
scharf abgewiesen.
Ende März oder Anfang April 1946 hieß es wieder: „Die Sachen packen und zum Abmarsch bereit sein“.
Danach wurden wir aus der Festung in Kolonne zu Fuß mit unseren Sachen zum Bahnhof nach Oradea gebracht.
Da wir bei allen diesen Märschen –vom Bahnhof zur Festung und jetzt wieder zum Bahnhof- unsere Sachen (Koffer, Säcke und
Bündel) nicht auf einmal mitnehmen und tragen konnten, hatte die Begleitwachmannschaft ihre Probleme mit uns und trieben uns
immer wieder zur Eile an. Der Transport unserer schwereren Sachen konnte durch uns immer nur in kurzen Etappen erfolgen, mit
einem Koffer nach dem anderen, immer wieder zurück gehen und den nächsten Koffer holen, bis alles wieder zusammen war. Doch
das hatte den rumänischen Soldaten gar nicht gefallen. So waren wir mit größeren Transportschwierigkeiten samt unseren Sachen in
Oradea auf dem Bahnhof angekommen und wieder –unter Bewachung- in einem geschlossenen Güterzug einwaggoniert.
Auch hier ging es -ohne Verpflegung- nach Sigeth/Maramuresch in Richtung Grenze zur „Karpaten Ukraine“, wo wir in Sigeth am
Bahnhof der sowjetischen Armee übergeben wurden. Dort in Sigeth ging es wieder in Marschkolonne mit unserem Gepäck und jetzt
unter sowjetischer Bewachung in die Kleinstadt Sigeth, wo wir in ein deutsches Internierungslager gebracht wurden.
Dieses Internierungslager war ein kriegsbeschädigtes Objekt eines einstigen Gymnasiums, wo nur die Turnhalle und einige kleinere
Räume belegt werden konnten. Hier waren vorher sowjetische Soldaten untergebracht.
Die Mehrheit unserer etwa 650 Internierten war in dieser Turnhalle untergebracht, wo es nur durchgehende Bettenlager gab, die aus
Brettern zusammengebaut waren und in drei Etagen belegt wurden. Ein Strohlager mit alten Decken darüber, ohne Tische und
Stühle. Da es hier im April schon recht warm wurde, war deshalb eine Beheizung nicht notwendig, aber dort gar nicht möglich.
Der Lagerkommandant war ein noch recht junger sowjetischer Oberleutnant, der Wachhabende war ein Feldwebel, dem etwa 20
Mann Wachmannschaft als Torposten und Außenstreifen unterstanden. Der Fourier war ein Feldwebel und der Koch ein Sergeant.
Der Lagerarzt war ein Major, ein gut deutsch sprechender Jude. Sie alle waren ebenfalls in diesem Objekt untergebracht.
Das Lager war nach allen Seiten mit Stacheldraht abgesichert, am Eingangstor war Tag und Nacht der Posten und wir deutschen
Internierte hatten zunächst keinen Ausgang in die Stadt. Der sowjetische Lagerkommandant suchte sich aus unserer Mitte einen
fähigen Mann als deutschen Lagerführer aus, der hieß Kissinger, stammte aus Czernowitz und beherrschte die russische Sprache.
Dieser deutsche Lagerführer war -mit noch weiteren seiner ausgesuchten Leute- für alle inneren Fragen im Lager – für unsere Leute-
zuständig. Auch der Fourier und der Koch suchten sich ihre Hilfskräfte aus dem Bestand unserer Leute aus. Dadurch hatten diese
Leute durch ihr dortiges Wirken einen guten Einfluss auf das Geschehen in der Verpflegungskammer und ganz besonders in der
Küche. Unsere Verpflegung war hier ausreichender und viel mehr als in den Internierungslagern bei den Rumänien in Oradea und
Radautz. Hier gab es je Person 650 Gramm Brot pro Tag, morgens Tee, mittags Suppe oder Kartoffeln mit Gemüse und abends Tee
sowie auch eine Suppe. Meist gab es dazu sogar noch einen Nachschlag.
Alle Männer vom 14. bis zum 60. Lebensjahr waren auch hier verpflichtet täglich von 09, 00 bis 17,00 Uhr zur arbeiten, entweder im
Lager oder in Außen-Arbeitskommandos. Jeden Morgen um 09,00 Uhr war für die arbeitspflichtigen Männer Antreten zur
Arbeitseinteilung und danach ging es in kleinen Gruppen (ohne eine Bewachung) zu den Arbeitsstellen, in ein großes sowjetisches
Militär-Versorgungslager, in die sowjetische Feldbäckerei oder auch zur Bezirks-Kommandantur. Öfter zum Bahnhof zum Be- oder
Entladen der Züge, auch die hier durchfahrenden sowjetischen Militärtransporte mit verschiedenen Waren für ihre Verpflegung zu
beliefern. Da Sigeth ein wichtiger Eisenbahn-Verkehrsknotenpunkt für die Truppenbewegungen zwischen der Sowjetunion - Ungarn –
Österreich war und diese hier durchfahrenden Transporte aus diesen sowjetischen Versorgungsstützpunkten am Bahnhof versorgt
wurden, hatten wir als Hilfskräfte viel damit zu tun.
Wir arbeiteten je nach Einteilung in allen diesen Versorgungsstützpunkten mit den örtlichen sowjetischen Soldaten zusammen und
wurden dort an diesem Arbeitstag auch offiziell gut versorgt. Abends im Lager stand uns auch noch das Lager-Mittagessen zu.
Mit der Durchführung dieser Arbeitseinsätzen in der Stadt Sigeth, wurde die Ausgangssperre für unser Lager aufgehoben und danach
konnte jeder in seiner Freizeit das Lager nach Belieben verlassen und sich unbegrenzt bis zum späten Abend in der Stadt Sigeth
aufhalten. Doch auch hier wusste niemand, wie lange wir hier bleiben müssen und was danach mit uns werden sollte.
Trotzdem es hier schon bedeutend besser war, wir gut satt wurden, die Arbeit Spaß machte und wir uns in der Stadt frei bewegen
konnten, war die plagende Ungewissheit über unsere Zukunft belastend.
Anfang Juni 1946 gab es auch hier den Befehl, „Sachen packen und zum Abmarsch fertig machen!“ Sowjetische Militärfahrzeuge
fuhren auf dem Hof und wir durften mit unseren Sachen diese Lkw besteigen, die uns alle im Pendelverkehr in Sigeth in ein
sowjetisches Militärlager brachten. Während wir bisher bei den Rumänen sowie auch bei der Sowjetarmee immer in Kolonne zu Fuß
marschieren und unser Gepäck tragen mussten, war es hier erstmalig, dass wir auf Lkw transportiert wurden.
In diesem sowjetischen Militärlager wurden wir neben den Baracken der sowjetischen Soldaten in einer extra für uns hergerichteten
Baracke Familienweise in Stuben locker untergebracht. Hier gab es Betten mit Strohsäcken und Decken, auch Tische und Stühle und
eine bessere Verpflegung aus der sowjetischen Militärküche. Hier brauchte niemand arbeiten, aber es gab für das ganze Militärlager
keinen Ausgang in die Stadt. Was von hier aus, mit uns werden sollte, wurde uns auch nicht gesagt und daher blieb auch jetzt die
Ungewissheit weiter bestehen. Unter unseren Leuten gab es wieder die spekulativen Diskussionen, wie: „Die halten uns jetzt für
„Sowjetbürger“ und jetzt geht es in den nächsten Tagen mit aller Sicherheit ab in die Sowjetunion.“
Doch nach etwa zwei Wochen Lageraufenthalt hieß es für uns wieder, „Sachen packen und sich für den Abmarsch bereit halten“.
Wohin, war für uns wieder ein Rätsel. Wir wurden mit unseren Sachen auf Lkw verladen und zum Bahnhof nach Sigeth gebracht, wo
wir am dortigen Abstellgleis in einem geschlossenen Güterzug eingewiesen wurden. Der erste Waggon war –wie immer- für die
sowjetische Wachmannschaft reserviert, der zweite als Versorgungswagen, der dritte war als Küchenwagen für die Erwachsenen und
der vierte Wagen war der Kinder-Küchenwagen, wo ich während unserer Reise neben dem Koch als Heizer und sein Helfer tätig war.
Da wir auf allen unseren bisherigen Transporten keinen solchen Luxus hatten, verstärkte sich die bisherige spekulative Parole unter
unseren Leuten, dass es jetzt mit uns, bestimmt in die Sowjetunion abgeht. Für jeden Waggon war wie üblich ein Waggonältester zu
bestimmen, der danach beim Transport-Kommandanten zur Besprechung zu erscheinen hatte. Bei dieser Besprechung wurde den
Waggonältesten erklärt, dass dieser Transport durch die Karpaten Ukraine und Ungarn sowie die Tschechoslowakei nach Deutschland
geht. Für diese Fahrt galten Verhaltensregeln, die die Waggonältesten ihren Landsleuten mitteilen sollten.
Die Waggonältesten erklärten ihren dortigen Landsleuten Folgendes:,
- diese Reise geht nach Deutschland,
- der erste Reiseabschnitt ist die Karpaten Ukraine, wo die Türen von außen geschlossen werden und das Aussteigen verboten ist,
- danach geht es durch Ungarn, mit offenen Türen und voller Bewegungsfreiheit,- durch die Tschechoslowakei ist auf den Bahnhöfen
Vorsicht geboten, unmittelbar am Transport bleiben, um nicht von den Tschechen als Deutscher überfallen und verprügelt zu werden.
-Bei drohender Gefahr, sofort die Waggontür schließen und die Begleitmannschaft verständigen.
Die sowjetische Begleitmannschaft wollte dort deswegen mit den Tschechen keine Probleme bekommen.
- Auf deutschem Gebiet wieder mit offenen Türen und voller Bewegungsfreiheit,
- Während des Transportes werden alle Personen an Haltestellen bzw. auf den Bahnhöfen drei Mal
täglich mit Essen versorgt, für Erwachsene und für Kinder extra. Das Essen wird waggonweise an den
Küchenwaggons empfangen und danach im Waggon ausgeteilt.
Die Bekanntgabe dieser Information durch den jeweiligen Waggonältesten an die Mitreisenden wurde mit großer Aufmerksamkeit,
aber auch mit sehr viel Misstrauen zum angesagten Reiseziel, aufgenommen. Danach wurde die Diskussion entfacht, „wenn es in die
Ukraine geht, dann geht es mit uns in die Sowjetunion, entweder in die Nordbukowina oder direkt nach Sibirien.
Der Transport setzte sich in Bewegung und damit stieg die Anspannung unserer Leute immer mehr an. Doch die weitere Reise nach
Deutschland verlief so wie es bei der Einweisung der Waggonältesten erläutert wurde und ohne Zwischenfälle. Diese spekulativen
Diskussionen mit Sibirien endeten erst in Ungarn, als die Waggontüren wieder von außen durch die Begleitmannschaft geöffnet
wurden und wir aussteigen durften. So fuhren wir gemütlich bei einer reichlichen Verpflegung drei Mal täglich, für Erwachsene und
für Kinder extra- in einer guten Woche aus Sigeth/Rumänien bis nach Riesa in Sachsen. Hier übergab uns die sowjetische
Wachmannschaft den deutschen Behörden, die uns in Riesa in einem Barackenlager untergebracht hatten.
Hier waren wir zunächst für vier Wochen in einem Quarantänenlager –bei Ausgangsperre- untergebracht und hatten ein viel mageres
und schlechteres Essen, als im sowjetischen Lager in Sigeth der Fall war. Aus diesem Lager heraus wurden wir dann in der dortigen
Umgebung von Riesa, Döbeln, Grimma, Wurzen, Torgau, usw. wohnlich untergebracht. Von da begann jeder von uns zuerst seine
Verwandten und Bekannten aus der alten Heimat Bukowina zu suchen, bevor man sich für seinen festen Wohnsitz und einer
Arbeitsstelle entscheiden wollte. So war jetzt jeder von uns froh, nach einer ungewollten Balkanrundreise Sibirien nicht erreicht zu
haben und dafür wieder in Deutschland angekommen zu sein.
Danach versuchte sich jeder mit der Zeit, hier eine neue Heimat zu schaffen.